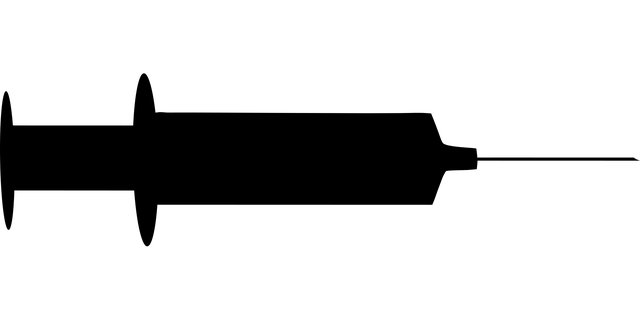Heidenangst statt Gottesfurcht?
Heidenangst statt Gottesfurcht?
Heute verlas unser Pastor die neuesten Pandemie-Verordnungen des Bistums. Diesmal ging es um Heizen und Lüften der Kirchenräume in der kalten Jahreszeit. Die Kirchenleitung kümmert sich rührend um die Gesundheit ihrer Gläubigen. Auch wies der Pastor nochmals darauf hin, beim Ausgang die Abstände einzuhalten. Man merkte ihm allerdings an, was er von dem ganzen Pandemie-Zirkus hielt.
In deutschen Gotteshäusern herrscht seit langem „Heidenangst statt Gottesfurcht“. So ist zumindest mein Eindruck. Wir haben zwar mit Christus nach offizieller Lehre den Tod überwunden („auferstanden am dritten Tage“), aber wenn es so richtig ernst wird, dann erreicht der Glaube nur unsere Lippen und nicht unsere Herzen.
Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Die Kirchen müssen diese Vorschriften einhalten, egal ob man sie persönlich für sinnlos oder überzogen hält wie der Verfasser dieser Zeilen. Ich hätte nur im „Haus des Herrn“ von vielen Beteiligten eine gelassenere Haltung erwartet. Schließlich sind wir zumeist keine unmündigen Kinder, die man mehrmals während eines Gottesdienstes ermahnen muss, die Hygieneregeln einzuhalten.
Aber mir geht es um etwas grundsätzlich anderes. Mir geht es nicht um Hygieneregeln, sondern um die Botschaft Christi. Als Christen haben wir Zeugnis von unserem Glauben abzulegen. Und die zentrale Botschaft Christi ist die Furchtlosigkeit. Jesu Ankunft in der Welt beginnt mit den Worten der Engel an die Hirten: „Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird“ (Lk 2,10). Und was Jesus selbst uns in der Bergpredigt: „Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Spanne verlängern? … Sorgt euch also nicht um morgen; denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug an seiner eigenen Plage“ (Mt 6, 27. 34). Wie aber deckt sich dieses Zeugnis mit der allseits verbreiteten Angst vor Krankheit und Tod?
Ein Freund von mir sandte mir von einiger Zeit einen Text von P. Klaus Mertes aus St. Blasien zu. „Wir kapitulieren vor dem Tod“ lautet sein Titel. Und Pater Mertes schreibt dort: „Im Ersten Korintherbrief heißt es: ‚Tod, wo ist dein Sieg, Tod, wo ist dein Stachel?‘ (1 Kor 15,55). In der Parallelstelle bei Hosea (13,14) heißt es sogar: ‚Tod, wo sind deine Seuchen, Unterwelt, wo ist dein Stachel?‘ Von diesem Osterjubel höre ich in den gegenwärtigen Debatten nichts. Vielmehr werde ich das Gefühl nicht los, dass wir – mit Tunnelblick auf den täglichen Todes- und Infektionsticker – vor dem Tod kapitulieren. Vor der Angst, infiziert zu werden. Vor der Schuldangst, andere zu infizieren“.
Und weiter schreibt er: „Kampf gegen das Sterben kann auch dem Tod Macht über das Leben geben“. So sehe ich das auch. Mit Heidenangst statt Gottesfurcht bekommt der Tod mehr und mehr Macht über unser Leben. Für uns Christen darf das nicht eintreten, sonst verlieren wir jede Glaubwürdigkeit als Zeugen für die Botschaft unseres Herrn. Wir Christen müssen Zuversicht verbreiten und sollten nicht mitsingen im Chor der Angstbeladenen.
Den kompletten Text von Pater Mertes finden Sie hier:
https://www.katholisch.de/artikel/25276-wir-kapitulieren-vor-dem-tod?fbclid=IwAR3mEo5Tu6P7vANQux5C52RJRoADuPEWz5DYV5ehDkifp3lJVsZo2DEfOLE